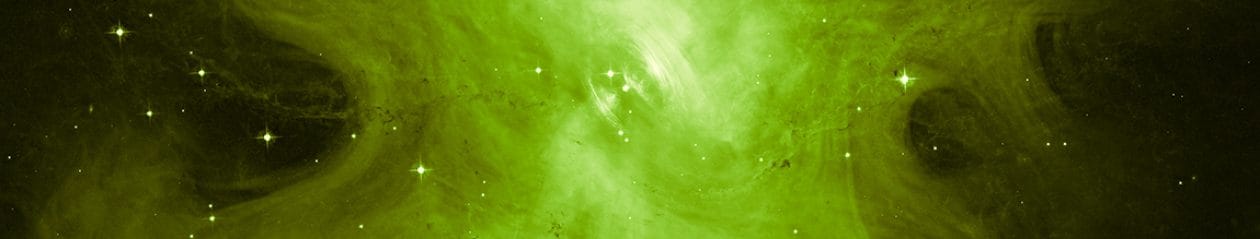Im TELEMATIK Spektrum-Gespräch: Dr. Niklaus Wirth
Zu seinem 60. Geburtstag wurde zu Ehren von Professor Dr. Niklaus Wirth an der ETH Zürich eine internationale Konferenz über «Programming Languages and System Architectures» abgehalten. Im Springer Verlag sind dazu die Lecture Notes in Computer Science Nr. 782 erschienen. Persönlichkeiten wie E.W. Dijkstra, C.A.R. Hoare, B. Lampson und M. Reiser waren zugegen und würdigten – jeder auf seine Art – den Computerpionier. In der Folge konnte TELEMATIK Spekrtrum (TS) mit diesem originellen Mann und elffachen Buchautor ein Gespräch führen. Sie erfahren hierin, warum er nicht nur Vater von Computersprachen sondern auch europäischer Telematikpionier ist. Das Interview wurde vom damaligen Chefredaktor des TELEMATIK Spektrums, Louis A. Venetz, am 7. Juni 1994 geführt.
TS: Wussten Sie schon früh, dass Sie Lehrer werden wollten?
Niklaus Wirth: Es war für mich schon früh klar, dass ich Ingenieur werden wollte. Auf welchem Gebiet war offen, denn das richtete sich nach den Fächern, die wir jeweils in der Mittelschule hatten. Nachdem mich beispielsweise der Modellflugbau viele Jahre begeistert hatte, neigten sich meine Interessen der Chemie zu. Als dann die Fernsteuerungen aus England auftauchten, ging ich doch wieder zum Modellbau zurück. Es dauerte nicht lange, musste ich mir Kenntnisse über diese Steuerung, also der Elektronik aneignen, weil sie nicht mehr funktionierte. Das war zu der Zeit, als ich mich für ein Studium entscheiden musste. So habe ich mich für die Elektrotechnik entschieden. Kurz nach diesem ETH-Studium merkte ich, dass ich nicht mein Leben lang nur Schaltungen verbessern sollte, sondern dass mir die Lehrtätigkeit mehr am Herzen lag. Zum Teil war das dadurch bedingt, dass meine Grossväter seit fünf Generationen Lehrer waren und dass mein Vater Mittelschullehrer für Geographie war. Ich bin allerdings zuerst nach Kanada, dann in die USA ausgewandert. Dort studierte ich weiter, doktorierte und erhielt schliesslich an der Stanford University eine Assistenzprofessur. Von da an waren die Weichen gestellt.
TS: 1974 wurde von Ihnen und Professor Zehnder der Vorschlag für einen Informatiklehrgang ausgearbeitet, und von der ETH abgelehnt. Wie ist es dazu gekommen?
Niklaus Wirth: Schon früh hat mich das neue Thema «Computer» fasziniert. Bei meinen Doktorstudium in den USA bin ich aus der Elektronik in jenes Gebiet vorgestossen, das man heute Software nennt. Was den Lehrgang angeht, war es 1974 schon der zweite Anlauf, der erste fand bereits 1971 statt. Wir sind damals gescheitert, nicht etwa weil die Schulleitung Widerstand geleistet hätte, sondern eher weil die Kollegen aus den etablierten Fächern dem neuen Gebiet ablehnend gegenüberstanden und ferner weil die Industrie einen Mangel an Interesse aufwies, obwohl wir pragmatisch vorgegangen sind und lediglich die Abteilung für Mathematik und Physik ausbauen wollten: Die ersten zwei Jahre wären praktisch unverändert geblieben, erst im dritten und vierten Jahr wäre ein drittes Fachstudium dazukommen.
TS: Was halten Sie von der sokratischen Lehrmethode im Kontrast zum heutigen Schulsystem?
Niklaus Wirth: Es spricht sicher viel für sie. Allerdings hat Sokrates immer einzelne Schüler oder kleine Gruppen unterrichtet. Das ist heute nicht mehr die Art, wie wir an der Universität vorgehen können. Einer Klasse von 200 Studenten gegenüberstehend, ist es unmöglich, diese Methodik zu praktizieren. Ich bemühe mich dennoch, nach jedem Unterrichtsabschnitt Fragen zu stellen und auf Fragen einzugehen. Das bedingt, dass der Student an diesem Fach interessiert ist, mitdenkt und kritisch eingestellt ist. Bei vielen Studenten habe ich den Eindruck, dass sie an die ETH kommen, um zu konsumieren. Das ist die falsche Einstellung für den akademischen Unterricht. Die Lehrer werden immer wieder aufgefordert, beim Unterricht zu motivieren. Ich finde das zwar nicht falsch, aber auch nicht hinreichend: An die Hochschule muss der Student Motivation mitbringen und wir müssen bedacht sein, diese nicht auszulöschen!
TS: Ist das heutige Schulsystem nicht mehr ideal?
Niklaus Wirth: Nein, es ist sicher nicht ideal. Dazu kommt, dass heute mehr Leute das akademische Studium nicht aus innerer Berufung ergreifen, sondern – so scheint es – weil sie nichts anderes noch weniger interessiert. Das ist vielleicht etwas hart ausgedrückt, und ich will sogleich betonen, dass auch sehr gute Studenten die ETH besuchen. An meinen Projekten nehmen stets gute, aktive Mitarbeiter teil, die persönliche Beiträge leisteten und die die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellten. Aber im Unterricht scheinen eben die anderen doch zu dominieren.
TS: Ging denn bei den Projekten immer alles reibungslos?
Niklaus Wirth: Es läuft nie alles reibungslos ab. Es gibt immer wieder Probleme, nicht nur technischer, sondern auch organisatorischer Natur. Aber ich darf ruhig sagen: Im allgemeinen haben wir an der ETH sehr günstige Voraussetzungen. Wenn jemand Ideen hat, hat er die Freiheit, diese zu realisieren, besonders bei Projekten, die nicht sehr finanzintensiv sind. Heutzutage ist man allerdings aufgefordert, nach Drittmitteln zu suchen. Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig, man ist damit gefordert, explizit Rechenschaft abzulegen über die Nützlichkeit eines Unterfangens. Andererseits muss ich vor den amerikanischen Verhältnissen warnen, wo die Universitäten fast nichts an die Forschung selber beitragen. Die Professoren beschaffen ihre Mittel selber, zum Beispiel aus der Industrie, vom Nationalfond oder vom Department of Defence (DoD), was dazu führt, dass sie vorwiegend damit beschäftigt sind, Research Proposals und Berichte zu verfassen, was von der eigentlichen Forschungstätigkeit ablenkt. Sie sind stets gezwungen, kurzfristig Resultate zu liefern.
TS: Sie haben bisher über zehn Projekte in Angriff genommen. Welches war rückblickend Ihr Lieblingsprojekt?
Niklaus Wirth: Das ist schwierig zu sagen. Man lebt mit jedem Projekt zu seiner Zeit. Dennoch glaube ich, dass der Höhepunkt wahrscheinlich Ende der 70er Jahre war, mit der Entwicklung einerseits der Sprache Modula und der dazuhörigen Software und andrerseits des Personal-Computers Lilith. Das Zusammenwirken der Software und Hardware war besonders interessant. Die Motivation und das Interesse der Mitarbeiter war da. Es war ein faszinierendes und vielversprechendes Projekt. In der jüdischen Mythologie war Lilith die erste Frau Adams. Lilith beanspruchte Frauenrechte; Adam war damit nicht zufrieden, hat sie verstossen, und sie wurde zur Dämonin. Jeweils nachts besuchte sie Männer, um sie abzulenken und zu verführen. Analog dazu hat auch unser Computer die jungen Mitarbeiter nachts heimgesucht und sie zum Arbeiten verführt, was ihm den Namen Lilith eintrug.
TS: Sie haben diese Lilith-Workstations vernetzt. Haben Sie europaweit Pionierarbeit im Bereich Networking geleistet?
Niklaus Wirth: Dem Lilith-Projekt war 1971 das Projekt Venus/Hexapus vorangegangen. Die ETH besass damals einen CDC Zentralrechner. Wir bauten ein interaktives System, das erlaubte, von einem Terminal aus Jobs einzugeben, Daten auszulesen, währenddem typischerweise der Rechner immer noch durch Lochkarten gespeist wurde. Zusätzlich zu den teuren Lochkarteneingabestationen (Satelliten) führten wir Kleinrechner ein und verbanden sie über fixe Leitungen mit dem Hauptrechner. Zur Programmierung dieser Kleinrechner benützten wir unserer Sprache Modula, wobei sich zeigte, dass sich mit Hilfe einer höheren Programmiersprache durchaus hardwarenahe Software ausdrücken lässt. Das Projekt wurde damals zusammen mit dem Rechenzentrum realisiert und hat sich bewährt. Beim späteren Lilith-Rechner war die Vernetzung vorgeplant. Dem ging voraus, dass ich 1976/77 im Rahmen eines Urlaubsjahres im Forschungslabor der Firma Xerox in Kalifornien weilte, wo diese Highpower-Arbeitsplatzrechner eigentlich erfunden wurden. Ich wünschte mir damals, auch an der ETH mit solchen Rechnern zu arbeiten, die aber auf dem Markt nicht erhältlich waren. Sie mussten eigenhändig erstellt werden. Eben: Lilith, verbunden durch ein Netzwerk. Ethernet wurde ebenfalls bei Xerox entwickelt. Meines Wissens war das damals wirklich das erste Ethernet in Europa, das 1982 in Betrieb genommen wurde und damals unsere 20 Arbeitsplatzrechner mit dem Rechenzentrum verbunden hat.
TS: Dann sind Sie doch in Europa ein Pionier für die Vernetzung?
Niklaus Wirth: Das können Sie so sagen, aber das Prinzip wurde bei Xerox entwickelt und ich habe es natürlich übernommen.
TS: Diese lokalen Netze werden heute mit den öffentlichen Netzen kombiniert. Ist daraus der Begriff «Telematik» entstanden?
Niklaus Wirth: Wir können uns heute kaum mehr einen Rechner vorstellen, der nicht mit anderen über ein Netzwerk verbunden ist. Und Telematik ist das Gebiet, das sich mit der Kommunikation unter Rechnern befasst. Dabei steht heute immer mehr die Integration von Computer-, Sprach- und Bilddaten im Vordergrund. Damit einher geht die Digitalisierung der Bild- und Sprachdaten. Das stammt daher, dass man sie mit dem gleichen Medium übertragen, sie im Computer verarbeiten und vorallem speichern können will. Das Speichern ist der wesentliche Punkt für die Digitalisierung. In diesem Sinn muss ich fast sagen: Informatik und Telematik sind kaum mehr zu trennen. Informatik ist ein Kürzel aus dem Französischen: «Information automatique«. Und jetzt kommt noch das «Tele«, also die Fernverbindung dazu. Ich würde eigentlich lieber sagen: «Tele-Informatik».
TS: Nein, lieber nicht, denn dann müssten wir den Namen unserer Zeitschrift ändern. – Die Workstation Ceres-3 hat überhaupt keine mechanischen Teile mehr. Sind Sie also der Erfinder der Solid-State-Technologie?
Niklaus Wirth: Die Ceres-3 ist, wie der Name sagt, eine Weiterentwicklung unserer Ceres-1- und Ceres-2-Rechner. 1988/89 mussten wir die alten Apple-Rechner im Unterricht ersetzen. Damals hatte ich den Vorschlag gemacht, eine Billigversion der Ceres selbst zu bauen, ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Unterrichts. Ich schätzte damals richtig, dass uns das billiger kommen würde. Innerhalb von vier Monaten hat 1990 unser Techniker im Alleingang 100 solche Rechner zusammengebaut. Für die Bedürfnisse des Unterrichts reichten vier MByte Hauptspeicher gut aus. Die Wartungsfreundlichkeit wurde erhöht, indem alle mechanischen Teile wegfielen. Wir haben explizit darauf hingearbeitet, den Energieverbrauch klein zu halten: Ohne den Bildschirm verbraucht der Ceres-3-Rechner rund 15 W, und dadurch wurde ein Ventilator überflüssig. In einem Raum mit bis zu 60 Rechnern weiss man die völlige Geräuschlosigkeit sehr zu schätzen. Es kommt aber immer darauf an, was man braucht und was es kostet. Wenn sehr viele Daten gespeichert werden sollen, dann ist der Minidisk immer noch das effektivste Speichermedium. Im Einführungsunterricht brauchten wir es nicht. Notabene, diese Rechner sind alle auch durch ein Netzwerk mit dem Plattenspeicher des Servers verbunden. Es gibt heute PCs, die auch völlig ohne mechanische Teile auskommen. Ich bin überzeugt, dass diese Lösung für viele Anwendungen das einzig Richtige sein wird. – Sie haben recht, wir waren in dieser Beziehung vier Jahre voraus.
TS: Sie haben neben den Computersprachen Pascal, Modula-2 auch Oberon entworfen. Oberon ist auch ein Betriebssystem. Haben Sie Oberon entwickelt, um dem Reiserschen Gesetz entgegenzuwirken?
Niklaus Wirth: Reisers «Gesetz» besagt, dass die Software schneller langsamer werde als die Hardware leistungsfähiger werde, dass die Software die von der Hardware neu zur Verfügung gestellte Leistung immer wieder wegfresse. Als Hochschullehrer habe ich die spezifische Aufgabe, den jungen Informatikern längerfristiges Wissen und Verständnis beizubringen und mitzugeben. Das heisst doch, dass wir eigentlich solche Systeme, seien es Compiler oder Betriebssysteme, afond erklären müssen. Ein System wie Windows oder Unix lässt sich jedoch niemandem mehr in seiner Ganzheit präsentieren. Das war einer der Gründe, das Oberon-System zu entwickeln, das man im Detail erklären kann und wo die Studierenden auch die Entscheidungen in der Konstruktion nachvollziehen können. Jürg Gutknecht und ich haben Oberon zusammen entwickelt, implemeniert und in einem Buch zusammengefasst: Project Oberon. Eine solche Entwicklung schien mir zur Pflicht von Universitätsprofessoren zu gehören. Leider tut das fast niemand. Man stellt vor, was da ist, wobei der Lerneffekt dann meistens bescheiden bleibt. Zudem – und jetzt komme ich auf Reiser zurück – ist es absolut unfassbar, dass unsere Softwaresysteme derartig wachsen. Etwas überspitzt muss ich sagen – sie wachsen, weil es die Hardware zulässt. Wäre die Hardware nicht soviel leistungsfähiger geworden, hätten sich die Softwareleute etwas mehr anstrengen müssen, um neue Ideen zu realisieren. Dass es möglich ist, mit bescheidenen Mitteln auszukommen, haben wir mit Oberon gezeigt. Es ist ein System, das alle modernen Betriebssystemideen implementiert, und das mit einem kleinen Bruchteil des Speicherbedarfs und der Rechenleistung auskommt, die sonst üblich sind.
TS: Ist Oberon syntaxmässig auch linksrekursiv aufgebaut, bis ins Betriebssystem hinein?
Niklaus Wirth: Wir müssen ganz klar unterscheiden, dass es eine Programmiersprache Oberon und ein Betriebssystem Oberon gibt. Letzteres umfasst ein Filesystem, ein Textsystem, ein Viewer (Window-)System, Device Drivers, Resourcen- und Speicherverwaltung. Aber die Sprache Oberon ist etwas für sich. Es ist vielleicht etwas unglücklich, dass beide den gleichen Namen haben. Der Zusammenhang besteht darin, dass das gesamte Betriebssystem Oberon in der Sprache Oberon formuliert ist. Ursprünglich wollten wir eigentlich die Sprache Modula verwenden. Dann haben wir eingesehen, dass die Typenerweiterung fehlt, die wir nicht missen mochten. Dieser kleine Zusatz hat alles eingebracht, was in Modula fehlte, um die Methode der objektorientierten Programmierung voll durchzuziehen. Ferner haben wir von Modula alles weggelassen, was wir für unwichtig hielten, nach dem Motto: Alles so einfach wie möglich machen.
TS: Ist das System Oberon gegen oben offen, so dass eine Erweiterung zum Beispiel für Paralell Processing möglich ist?
Niklaus Wirth: Das Thema «Parallele Prozesse» haben wir ganz bewusst ausgeklammert, einfach, um das System mit einem Zwei-Personen-Team innerhalb nützlicher Frist zu realisieren. Doch haben wir damit gezeigt, dass man mit dem einfachen Single-Task-Konzept sehr viele Dinge realisieren kann, wo man bisher Parallele Prozesse für unabdingbar gehalten hatte. Sicher gibt es Anwendungen, die inherent Parallel Processing verlangen. Kürzlich wurde auch eine Arbeit über dieses Thema gemacht, die das Oberon-Grundsystem für die Mehrprozessfähigkeit erweitert hat. Das Oberon-System umfasst eine Hirarchie von Modulen. Die Module sind diejenigen Programmeinheiten, die der Compiler als Einheit übersetzen und einfügen kann. Das Betriebssystem ist die Gesamtheit jener Module, die immer vorhanden sein müssen. Die Idee der Lean Software besteht darin, dass man zu diesem kleinen Kern nur das hinzufügt, was man wirklich braucht. Alles andere ist wegzulassen. Die enorme Grösse der kommerziellen Systeme kommt daher, dass sie von Anfang an eine Menge von Modulen beinhalten, gleichgültig, ob sie zum Einsatz gelangen oder nicht.
TS: Bei Ihrer Laudatio zum 60. Geburtstag wurde erwähnt, dass Sie Bill Gates geholfen haben, den Prozess gegen Apple zu gewinnen. Stimmt das?
Niklaus Wirth: Ich habe ihm Informationen liefern können, die halfen, den Prozess zu gewinnen. Auf einer Ferienreise im Westen der USA bin ich in Seattle vorbeigekommen. Zusammen mit einem Freund verbrachte ich einen Tag bei Microsoft. Beim Nachtessen mit Bill Gates kam der Prozess zwischen Microsoft und Apple zur Sprache, in dem Apple die Erfinderrechte für die Fenstertechnik geltend machte. Dazu meinte mein Begleiter, wir hätten bereits 1980 die Fenstertechnik beim Lilith-Rechner (mit Maus und Bitmap-Display) zur Verfügung gehabt. Bill Gates fragte: «Könnt Ihr uns das beweisen?» Und mein Begleiter lieferte danach die nötigen Unterlagen. Was Apple damals auf den Markt gebracht hatte, war das, was Xerox versäumt hatte, vorher zu tun.
TS: Bei so viel Pionierarbeit, wären Sie da nicht auch wie Bill Gates prädestiniert gewesen, einer der reichsten Männer der Welt zu werden?
Niklaus Wirth: Man kann natürlich immer über die Vergangenheit spekulieren, aber meine Interessen lagen im technischen und nicht im kommerziellen Bereich. Steven Jobs hatte genau diese kommerzielle Ader. Das Verdienst von Apple ist es gewesen, diese Ideen aufzugreifen und in ein Produkt umzuwandeln, das auch klein und billig genug war, um auf dem Markt durchzuschlagen. Als Hochschulprofessor hat man andere Pflichten und Verantwortungen. Daneben hatte ich keinen Drang, Firmen aufzuziehen und mich zu bereichern.
TS: Würden Sie uns einmal sagen, was Sie sonst nie sagen würden, einen Rat?
Niklaus Wirth: Da schieben Sie mir in eine schwierige Rolle zu. Es ist ja schwierg genug, Individuen Rat zu geben, noch schwieriger einer Allgemeinheit, die man nicht einmal vor sich sieht. Aber ich möchte jungen Leuten, die noch nicht entschieden haben, welchen Weg sie gehen wollen, sagen, dass die Technik unglaublich viele interessante Möglichkeiten und Herausforderungen bietet, wenn man dafür Interesse aufbringt. Ich bedaure, dass in der Schweiz die Technikfreundlichkeit stark zurückgegangen ist. Zu meinen Zeiten war die Technik ein vielversprechendes Gebiet. Als erfolgreicher Ingenieur hatte man Ansehen, man war stolz auf die ETH als Hochburg dieser Technik. Heute wird die Technik gerne als Sündenbock für alle Arten von Missständen benutzt. Man sollte sich wieder einmal darauf besinnen, dass die Technik faszinierende, intellektuelle Herausforderungen für nutzbringende Produkte bietet. Man sollte sich per se um Wissen und Können bemühen. Stattdessen wird stets gefragt, wieviel Geld es bringe. Dies scheint mir die Krankheit der heutigen Zeit zu sein: Die Untrennbarkeit von Kommerz, Technik und Macht. Ich trenne diese ganz deutlich, denn die Technik fordert den menschlichen Geist heraus, weckt die Findigkeit und die Neugierde. Andrerseits kann man sich fragen, was die Technik in den Verruf gebracht hat. Natürlich, dass sie missbraucht worden ist. Dafür ist aber nicht die Technik verantwortlich, sondern diejenigen, die die Errungenschaften missbrauchen.
TS: Wie kommen wir aus dieser Technikfeindlichkeit wieder heraus?
Niklaus Wirth: Die stärkste Beeinflussungsmöglichkeit bietet die Ausbildung. Da aber die Hochschule am Schluss der Kette liegt, können wir kaum mehr korrigieren. Deshalb bedaure ich den Trend in den Grundschulen, Gymnasien und Mittelschulen, bei den Naturwissenschaften, kurzum bei allen exakten Wissenschaften abzubauen (von Technik ist dort ohnehin nicht die Rede). Ich meine damit keineswegs, dass die humanistischen Fächer, die Sprachfächer unwichtig seien. Aber der Trend ist allzu einseitig; und noch einseitiger zu werden, ist sehr bedauerlich. Deshalb begrüsse ich – auch nach den kleinen Retouchen – die neue Maturitätsreform nicht, obwohl sicher manches reformbedürftig wäre. Eine weitere Tendenz ist – auch in der Schweiz -, den Dingen nicht mehr mit Geduld und mit Ausdauer nachzugehen. Man bleibt zuviel an der Oberfläche hängen, sei es bei politischen Debatten, sei es bei Projekten. Das scheint mir mit ein Grund dafür zu sein, dass die Industrie in gewissen Gebieten arg ins Hintertreffen geraten ist. Es ist uns in den letzten 50 Jahren sehr gut ergangen. Das führte fast unweigerlich dazu, dass man sich an den Wohlstand gewöhnt und sich nicht mehr bewusst ist, dass sich jemand dafür eingesetzt hatte. Kürzlich las ich auf einem Auto die Aufschrift: «The worst day of golf is better than the best day of work.» Das ist eine prägnante Zusammenfassung von dem, was wir meiner Meinung nach korrigieren müssen. Gearbeitet wird offenbar nur, um damit Geld zu kriegen, um nachher Golf zu spielen. Die traditionelle Trennung von Arbeit und Freizeit ist unselig. Arbeit ist dann eine Mühsal, wenn sie etwas betrifft, wofür man sich nicht interessiert, und daher nicht einsetzen kann. Das Objekt des Interesses muss nicht ein Computer oder etwas Hochgeistiges sein. Man kann sich unter Umständen auch für kleine, alltägliche Dinge interessieren. Wenn man das nicht kann, wird die Arbeit zur Plage und das Leben wird sauer.
TS: Was sagen Sie zur Menschheitssituation? Was würden Sie ändern?
Niklaus Wirth: Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin! Es gibt Leute, die behaupten, dass die Hoffnung für eine Besserung in der Technik liege, gerade in der Telematik, wo man überallhin Verbindungen habe, wo man nicht mehr überall physisch herumfahren müsse, weil alles auf dem Pult, auf dem Bildschirm vorhanden sei, wodurch man mehr Kontakte und auch mehr Verständnis für die anderen erlange. Ich habe den Verdacht, dass diese Meinung einem Zweckoptimismus entspringe. Andrerseits ist es unverkennbar, dass die technischen Fortschritte unweigerlich den Graben zwischen denjenigen, die an der Spitze sitzen, und den «Konsumenten» vergrössern. Wie der Graben zu schmälern sei, weiss ich nicht. Ich stelle einfach fest, dass diejenigen, die sich bessere Werkzeuge (Techniken) erarbeiten, schneller noch bessere Werkzeuge erhalten: ein inhärenter Zirkel!
TS: Ist nicht die Ethik und Moral der heutigen Zeit verantwortlich?
Niklaus Wirth: Sie ist mehr verantwortlich als die Technik! Der vorwiegende Trend ist heute der Egoismus. Jeder arbeitet im wesentlichen für seinen eigenen Vorteil. Dass nicht die Technik für diesen Trend verantwortlich gemacht werden sollte, zeigt sich am Beispiel Fernosten. Noch vor kurzem galten Indien und die meisten fernöstlichen Länder als unterentwickelt. Wir kaufen heute rund 90 Prozent der Electronicware in diesen Staaten ein, wo sie auch hergestellt wird. Wohin vergibt man heute Software? Nicht ins nächste Haus qualifizierter Schweizer, sondern nach Indien mit der Begründung, die Entwicklung und die Produktion sei in der Schweiz viel zu teuer. Als Folge davon wandert die eigentliche Wertschöpfung zusehends ins Ausland ab, und es verbleiben vorwiegend Verwaltung und Handel. Das macht mir Kummer.
TS: Haben Sie eine Vision?
Niklaus Wirth: Nein, eigentlich nicht. Dazu bin ich zu nüchtern. Als man mich vor 10 Jahren fragte, wie die Comptertechnik aussehen würde, hatte ich gewisse Entwicklungen extrapoliert. Es ist ganz anders geworden. Man hätte viel weiter extrapolieren müssen. Die Zukunft vorauszusagen, ist nicht meine Spezialität. Und man irrt sich selbst im eigenen Gebiet allzu leicht. Aber sicher ist, dass die Computeranwendungen gerade dank der Kommunikationsmöglichkeiten mehr und mehr alle Bereiche unserer Tätigkeiten durchdringen werden, da wir Werkzeuge erhalten, mit denen wir manches handlicher machen können. Wir sollten lernen, diese Technik zu beherrschen und anzuwenden. Umgekehrt passiert es sonst, dass die Technik uns beherrscht. Und damit sind wir wieder bei der Ausbildung: Es werden unzählige Kurse angeboten, auch an unserer Hochschule. Das Meiste, was wir tun, ist Wissen zu vermitteln. Aber was Not tut, ist Verständnis zu vermitteln. Wenn wir ein superkompliziertes Betriebssystem wie Windows einsetzen, können wir doch das nicht in ein paar Stunden, in ein paar Tagen lehren. Und leider sind diese Systeme noch so unsystematisch organisiert, dass man recht bald einmal ihr Opfer wird. Es passiert dann Unvorhergesehes in Situationen, die entweder nicht beschrieben sind, oder die man in den «Wälzern» nicht findet. Natürlich muss nicht jeder Anwender das Windows-System in seinen Innereien kennen, aber seine Konzepte sollten verständlich sein. Sonst ist der Anwender dem Computer (und seinen Verkäufern) ausgeliefert.
TS: Es gibt Leute, die sich schwer tun in der Bedienung des Computers. Sind Computer noch nicht menschenfreundlich und warum verstehen sie unsere Sprache nicht?
Niklaus Wirth: Mit der Feststellung stimme ich überein, aber nicht mit der Schlussfolgerung. Denn ich möchte gar nicht mit einem Computer sprechen können wie mit einem Mitmenschen. Das sind zwei verschiedene Dinge, die Kommunikationsparadigmen sind anders. Mit dem Computer geht es dann am besten, wenn ich unzweideutig meine Anweisungen mitteilen kann. Das geschieht sehr effektiv mit Tastatur, Maus und Bildschirm. Es mag Anwendungen geben, wo Spracheingabe wichtig ist, aber die Schwierigkeit der «einfachen» Computernbenützer würde wahrscheinlich mit der Spracheingabe nur noch vervielfacht. Auch wenn moderne «Benutzeroberflächen» manche Arbeit erleichtern, so bleiben sie dennoch Oberflächen. Letztlich kommt es auf den Inhalt an. Man hüte sich also vor der Überbetonung von Äusserlichkeiten, auch wenn sie noch so wundervoll erscheinen.
TS: Warum verarbeiten wir mit dem Computer überhaupt Zeichen und Buchstaben anstatt Wörter und Begriffe unserer Sprache?
Niklaus Wirth: Zeichen und Buchstaben sind codierte Werte wie Zahlen, ohne inhärente Bedeutung. Wörter und Begriffe hingegen haben für uns eine assoziierte Bedeutung (Semantik), die interpretierbar, oft vage und subjektiv ist, und uns im Zusammenhang verständlich ist. Computersysteme, die mit Wörtern und Begriffen arbeiten, gibt es (Knowledge-based Systems) und sie sind erfolgreich, wenn ihr Wortschaftz klein sein darf und die Ansprüche an ihr «Verständnis» in Grenzen bleibt. Ich möchte abschliessend aber warnen vor der Hoffung, dass wir dereinst wichtige Probleme und Entscheidungen auf «verständige» Computer abwälzen können.
TS: Vielen Dank für das lehrreiche Gespräch und herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag.